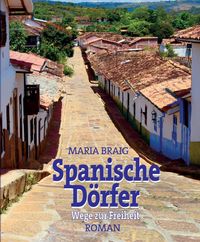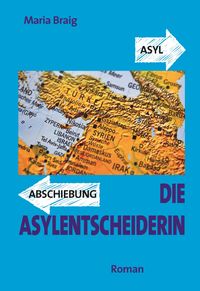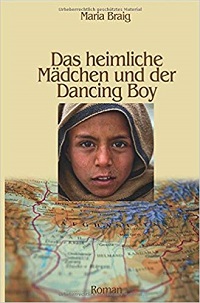Katrin Nansens Zeitangabe war korrekt. Ziemlich genau eine halbe Stunde später konnte Delia ein Stück abseits von der Straße einen alleinstehenden alten Hof erkennen. Etwa zweihundert Meter weiter gab es noch eine andere Hofstelle, aber die war viele Jahre jünger und in wesentlich besserem Zustand, soweit sie das aus der Ferne erkennen konnte. Hier wirtschaftete vermutlich der junge Bauer, der Martjes Land gepachtet hatte. Von der Hauptstraße führte ein kleiner asphaltierter Weg direkt zum alten Hof. Den schlug Delia ein und schon wenige Minuten später konnte sie eine alte Frau erkennen, die in einem kleinen Blumengarten vor dem Haus herumwerkelte. Also kein Mittagschlaf. Glück gehabt, dachte Delia und näherte sich dem Haus. Die alte Frau hatte sie kommen gehört und kurz aufgesehen, widmete sich dann aber wieder dem Garten.
„Sie haben aber schöne Blumen“, sagte Delia, als sie am Gartenzaun angekommen war.
Nun richtete sich die Alte auf, um die Spaziergängerin zu begrüßen. Sie öffnete den Mund und schloss ihn wieder, ohne etwas zu sagen. Sie starrte Delia wortlos an.
„Entschuldigen Sie, ich hatte gedacht, Sie hätten mich bemerkt“, sagte die. „Ich wollte Sie nicht erschrecken.“
„Schon gut, ich dachte nur ganz kurz, Sie wären jemand anderes.“
Ihre Stimme klang etwas rau, aber warm und Delia fühlte sich sofort wohl in ihrer Gegenwart.
„Sind Sie Jessens Martje, der Bauer?“, fragte sie dann. „Ich bin Delia.“
„So hat mich schon lange niemand mehr genannt. Wer hat Sie denn geschickt?“ Martje lachte. „Kommen Sie doch herein. Haben Sie Lust auf ein Tässchen Tee? Ich bekomme so selten Besuch, da muss ich jede Gelegenheit nutzen.“
Es war zwar noch nicht lange her, seit sie Kaffee getrunken hatte, aber Delia wollte die Gunst der Stunde nutzen. Sie ging durch das kleine Gartentor, das hinter ihr von allein zufiel.
„Kommen Sie zum Haus und setzen Sie sich. Ich muss erst mal die Hände waschen, sie sind ganz schmutzig von der Gartenerde“, sagte Martje und zeigte auf eine Bank an der Hauswand, vor der ein schwerer Holztisch stand. „Ich mache dann auch gleich Tee für uns.“
Martje verschwand im Haus, während Delia sich auf der Holzbank niederließ und die Sonnenstrahlen genoss. In Griechenland wäre es jetzt zu heiß, um direkt in der Sonne zu sitzen, ging es ihr durch den Kopf. Wie es diesem Mädchen Annemarie wohl ergangen war, als sie von der Insel in der Nordsee in die Ägäis gekommen war?
Als Martje Jessen mit Tee, Sahne, Klüntjes und Keksen, alles auf einem kleinen Tablett samt friesischen Tassen und kleinen Löffeln zusammengedrängt, aus dem Haus kam, war Delia eingeschlafen.
Martje stellte das Tablett ab und setze sich leise ihrem Gast gegenüber an den Tisch. Sie nutzte die Gelegenheit um dieses Gesicht, das sie auf den ersten Blick sofort an Annemarie erinnert hatte, in Ruhe zu betrachten. War diese starke Ähnlichkeit wirklich da oder bildete sie sich etwas ein? Da hatte es doch einmal eine Tante von Annemarie gegeben, die diese als junges Mädchen fast ein Jahr lang pflegte und von der sie vorher nie etwas gehört hatte. Annemarie hatte damals erzählt, wie schön es auf dieser griechischen Insel gewesen war, wie gerne sie ihre Tante hatte und dass sie am liebsten später einmal zu ihr ziehen wollte. Plötzlich kamen die alten Geschichten wieder hoch. Warum hatte diese Tante nie nach Annemarie gefragt, die ganzen Jahre nicht, wenn sie doch so eine enge Beziehung zu ihrer Nichte gehabt hatte? Und diese Frau, diese Delia, die jetzt vor ihr saß? Sie hatte einen leichten ausländischen Akzent, den Martje allerdings keinem bestimmten Land zuordnen konnte. Die Tante konnte es auf keinen Fall sein, dazu war sie viel zu jung. Aber vielleicht ihre Tochter? Hatten die Verwandten in Griechenland sich plötzlich doch erinnert? Oder war die Ähnlichkeit ein reiner Zufall, ein Spiel der Natur?
Delia erwachte und Martje goss Tee in die Tassen, als ob sie eben erst an den Tisch gekommen wäre.
„Bin ich etwa eingeschlafen? Wie unhöflich von mir, es tut mir leid“, entschuldigte sich Delia.
Martje lachte. „Das macht die Seeluft. Wie Ihnen geht es vielen Gästen auf der Insel. Aber nun sagen Sie mir, wer Sie geschickt hat. Ich bin doch ziemlich neugierig, wer mich heute noch immer Jessens Martje, der Bauer nennt.“
Delia nahm einen Schluck Tee und überlegte, während sie ganz langsam trank, um Zeit zu gewinnen, wie sie beginnen sollte. Die Situation war doch sehr ungewöhnlich und sie wollte die alte Frau auch nicht an Dinge erinnern, von denen sie möglicherweise gar nichts mehr wissen wollte. Aber es ging nicht anders, sie konnte nur versuchen, möglichst schonend vorzugehen.
„Niemand hat mich geschickt“, sagte Delia und sah Martje forschend an, um auf jede unverhoffte Reaktion reagieren zu können. Sie wollte nicht riskieren, dass sie den Rettungswagen rufen müsste, weil sie selbst Martje vielleicht als Gespenst aus der Vergangenheit erschien. „Es ist eine komplizierte Geschichte und ich sollte vielleicht ein bisschen ausholen“, begann sie vorsichtig.
Martje nickte erwartungsvoll, sagte aber nichts.
„Ich bin wie Sie auf einer Insel aufgewachsen. Allerdings auf einer griechischen Insel in der Ägäis. Später bin ich von dort weggegangen, um zu studieren, und habe dann viele Jahre in Athen gelebt. Meine Mutter blieb nach dem frühen Tod meines Vaters allein in einem kleinen Häuschen auf unserer Insel und ich habe sie besucht, so oft es ging. Sie und meine Insel. Ich habe selbst eine Tochter, sie ist schon erwachsen und selbstständig, aber als Kind war sie oft mit mir dort. Wir haben fast alle Schulferien bei meiner Mutter, ihrer Großmutter, verbracht. Seit sie erwachsen ist, hat sie Omis Insel, wie sie sagt, häufig mit ihrer Lebensgefährtin zusammen besucht.“ Delia sah auf, um Martjes Reaktion zu beobachten. Sie hatte absichtlich erwähnt, dass ihre Tochter in einer Beziehung mit einer Frau war, in der Hoffnung, Martjes Vertrauen zu gewinnen.
Martje räusperte sich. „Wie schön, dass man heute so offen darüber sprechen kann“, sagte sie. „Mir fällt es immer noch nicht ganz leicht, von meiner Ulrike zu erzählen.“
Delia nickte. „Leider ist es auch heute noch nicht überall und in allen Familien so. Meine Tochter hatte Glück. Selbst ihre Großmutter fand es völlig okay, dass sie ihre Freundin Filipa mitbrachte. Wir haben uns beide darüber gewundert.“
„Aber was führt Sie nun zu mir?“, fragte Martje nach einer kurzen Gesprächspause.
„Wo war ich stehengeblieben?“ Delia überlegte kurz. „Ach ja, Omis Insel. Ich will es kurz machen. Vor ein paar Monaten ist meine Mutter gestorben und wir haben uns nach längerem Überlegen entschlossen, ihr Haus zu behalten und für Feriengäste herzurichten.“
„Das tut mir sehr leid“, sagte Martje. „Also das mit ihrer Mutter, meine ich. Das mit dem Haus ist doch eine schöne Idee.“
„Ich wollte das erst nicht, aber nachdem meine Tochter versprochen hat, sich um das Haus zu kümmern, war ich gerne einverstanden. Irgendwie hänge ich ja doch an meiner Insel und am Haus meiner Eltern, in dem ich aufgewachsen bin.“
„Ich bin nie von hier weggekommen“, warf Martje versonnen ein. „Jedenfalls nicht für lange. Ich habe es versucht, aber ich bin kläglich gescheitert. Ohne meinen Hof und die Insel habe ich es nicht ausgehalten und meine arme Ulrike musste darunter leiden. Wir haben es dann auch nicht auf Dauer zusammen geschafft.“ Sie seufzte. „Warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Wir kennen uns doch kaum“, wunderte sie sich dann über sich selbst. „Aber nun habe ich Sie schon wieder unterbrochen. So wird das nie etwas.“
„Die Geschichte ist auch fast zu Ende“, fuhr Delia mit ihrem Bericht fort. „Leda, meine Tochter, hat begonnen, das Haus herzurichten, und dabei hat sie auf dem Dachboden ein paar alte Briefe gefunden.“ Delia griff nach ihrer Jacke, die sie über die Lehne der Bank gelegt hatte. Sie zog die drei verknitterten Briefe, die in der Keksdose so viele Jahre überdauert hatten, aus der Tasche und legte sie vor Martje auf den Tisch. „In diesen Briefen erzählt eine Annemarie von Ihnen und sie nennt Sie Jessens Martje, der Bauer.“ Delia überlegte kurz, dann legte sie auch den Vertrag, den Annemarie mit Enna geschlossen hatte, auf den Tisch. „Ich bin hierhergekommen, um herauszufinden, was damals geschehen ist. Wer diese Annemarie ist und ob stimmt, was ich den Briefen und diesem Papier hier zu entnehmen glaube. Und vielleicht können Sie mir dabei helfen.“
Martje las den Vertrag in Kinderschrift und wurde blass. Dann las sie die drei Briefe. Sie ließ sich Zeit, es schien Delia, als wolle sie auch nicht die kleinste Einzelheit übersehen. Als sie fertig war, begann sie von vorne, und als sie alles zweimal durchgelesen hatte, schob sie die Papiere über den Tisch zu Delia.
„Was ist denn aus dieser Annemarie geworden? Hat Ihre Mutter nichts von ihr erzählt?“
„Meine Mutter erzählte sehr wenig und nur, wenn man sie sehr bedrängte, aus ihrer Vergangenheit. Ich habe sie als Jugendliche mit Fragen nach ihrer Familie genervt, ich wollte wissen, wo meine Wurzeln lagen, wie man so sagt. Die Familie meines Vaters lebte auf der Insel und auf dem griechischen Festland. Man sah sich bei Familienfesten und wusste zumindest voneinander. Von der Familie meiner Mutter wurde nie gesprochen. Alles, was ich aus ihr herausbringen konnte, war, dass sie mit einem ehemaligen Zwangsarbeiter als Mann nicht auf ihrer deutschen Heimatinsel bleiben konnte und wir deshalb in Griechenland lebten, wo sie sehr lange Zeit als die Deutsche galt, die man eigentlich nicht bei sich haben wollte. Ich habe immer wieder nachgebohrt, wollte wissen, wo ihre Familie lebt, aber ich erfuhr lediglich, dass es nur einen Bruder und seine Frau gegeben hatte und dass diese bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind, als ich noch ganz klein war. Erst gestern ist mir wieder eingefallen, dass sie einmal erwähnt hat, dass in diesem Auto auch noch eine Nichte von ihr saß, die ebenfalls ums Leben kam. Ich nehme an, dabei handelt es sich um diese Annemarie.“
„Geben Sie mir etwas Zeit, Delia“, bat Martje. „Das kommt alles ein bisschen plötzlich. Lassen Sie uns ein paar Schritte gehen.“
Die beiden Frauen verließen schweigend den Garten und Delia folgte Martje auf einem kleinen Pfad, der hinter dem Haus durch die Wiesen führte. Es roch anders als in Griechenland, wo die Kräuter in der Sonne manchmal fast den Geruch des Meeres überdeckten. Aber es summte und brummte im Blühstreifen, der den schmalen Weg säumte, der zu einem kleinen Teich führte. Am Wasser stand eine Bank. Martje setzte sich und klopfte neben sich auf das Holzbrett. Setz dich zu mir, Delia. Darf ich du sagen? Es scheint mir ganz passend für das, was ich dir nun erzählen werde.“
Delia nickte gespannt, sagte aber nichts.
„Annemarie war als junges Mädchen oft bei mir auf dem Hof. Heimlich, ihre Eltern durften nichts davon wissen, denn auf der ganzen Insel war bekannt, dass ich nicht normal war, dass ich so eine war. Annemarie hatte davon gehört, nachdem ihre Mutter, Grete Ekhoff, sie nackt mit ihrer Freundin Geske im Bett erwischt hatte. Geske wurde daraufhin von der Insel weg in ein Mädchenpensionat auf dem Festland geschickt und aus Annemarie sollte nun endgültig ein richtiges Mädchen werden. Die Familie hatte im Weltkrieg zwei ältere Brüder Annemaries verloren und der Vater, der selbst noch sehr lange unter seinen Erlebnissen im Krieg litt, hatte das Mädchen glauben gemacht, sie könne die Brüder für ihn ersetzen. Annemarie war als halber Junge aufgewachsen und als sie in die Pubertät kam, sollte sie plötzlich ein Mädchen mit allen Einschränkungen, die das damals bedeutete, werden. Das funktionierte natürlich mehr schlecht als recht. Dann kam Geske ins Spiel, Annemarie wurde mädchenhafter, passte sich der neuen Freundin an, aber was sich dann zwischen den beiden entwickelte, war natürlich auch nicht gewollt. Als Geske von der Insel verbannt worden war, setzte Grete Ekhoff alles daran, ihre Tochter so hinzubiegen, dass man sie eines Tages mit einem passenden jungen Mann verheiraten könnte, der dann das Gut übernehmen sollte. Passend hieß in dem Fall: Geld zu Geld, Einfluss zu Einfluss. Annemarie wollte nicht einsehen, dass sie den Hof nicht selbst führen könnte, und sie hatte von Jessens Martje, dem Bauern gehört. Wenn Martje ein Bauer sein konnte, dann könnte sie das doch auch, versuchte sie den Eltern klarzumachen, stieß dabei aber selbstverständlich auf Granit. Jessens Martje ist eben seltsam, so sagte man ihr, und mein Hof wäre schließlich nicht zu vergleichen mit dem Gut der Ekhoffs. Annemarie wollte sich selbst ein Bild machen, schlich um meinen Hof herum und ließ sich von mir erwischen. Von da an war sie häufig zu Gast, half mir, wo sie konnte, aber niemand durfte davon erfahren. Das musste ich ihr versprechen. Ich nehme an, sie hatte recht mit der Annahme, dass man ihr sonst keine Gelegenheit mehr gegeben hätte, mich zu besuchen.
Annemarie wurde dann ganz nach Plan mit dem Sohn des reichen Bauern Ole Hanssen verlobt. Sie war noch sehr jung und die Hochzeit sollte frühestens stattfinden, wenn sie achtzehn Jahre alt geworden war.“
Martje machte eine Pause.
„Wenn es Sie zu sehr anstrengt, kann ich auch morgen wiederkommen“, überwand sich Delia zu sagen. Sie wollte die Geschichte unbedingt weiterhören, Martje aber auch nicht überanstrengen. Das alles schien die alte Frau ziemlich mitzunehmen.
„Du, Delia. Wir sagen doch du zueinander“, erinnerte Martje und nahm Delias Hand in die ihre. „Es strengt mich an, weil es vieles aufrührt in mir. Aber ich möchte gerne weitererzählen.“ Sie setze sich zurecht, ließ dabei aber Delias Hand nicht los.
„Du weißt vielleicht, Delia, dass man damals in Deutschland vor dem Gesetz erst mit einundzwanzig Jahren als erwachsen galt? Annemarie wollte auf keinen Fall heiraten, aber sie konnte nichts gegen die Pläne ihrer Eltern tun, solange sie minderjährig war. Sie hoffte noch immer, eines Tages wieder mit ihrer Freundin Geske zusammenzukommen, aber selbst, wenn sie allein bleiben sollte, sie wollte auf keinen Fall einem Mann gehören, wie sie das nannte. Ich versprach ihr, sie nach Kräften zu unterstützen, aber wirklich helfen konnte ich ihr nicht.
Dann fuhr ich über Weihnachten und Silvester zu meiner Freundin Ulrike nach Hamburg. Als ich zurückkam, war Annemarie irgendwie anders, aber sie wollte nicht damit herausrücken, was geschehen war und was sie so bedrückte.“ Martje verstummte, ließ Delias Hand los und wischte sich über die Augen. „Jetzt, so viele Jahre später, weiß ich endlich, was damals passiert ist. Das arme, arme Mädchen. Ich hätte es erkennen müssen damals, was Ole ihr angetan hat. Vielleicht, wenn ich nicht so mit mir selbst beschäftigt gewesen wäre – Ulrike und ich überlegten damals, dass ich den Hof aufgeben und zu ihr in die Großstadt ziehen sollte. Als lesbisches Paar auf der Insel zu leben, war einfach nicht denkbar – vielleicht hätte ich ihr dann helfen können?“
Delia legte ihren Arm um die alte Frau. „Du hättest nichts ändern können, Martje, das weißt du. Du warst für sie da. Das zählt.“
„Wahrscheinlich hast du recht, Delia. Trotzdem …“
Nach längerem Schweigen stand Martje von der Bank auf. „Delia, es tut mir leid, für heute muss es genug sein. Ich kann nicht mehr, das nimmt mich doch ziemlich mit, was ich aus diesem Brief erfahren habe. Ist es dir recht, wenn ich morgen weitererzähle?“
Delia nickte. Sie war enttäuscht, aber sie hatte auch Verständnis für Martje. Schweigend gingen die beiden zurück zum Haus.
„Vielen Dank für deinen Besuch, Delia.“ Martje nahm die Frau aus Griechenland, die sie noch vor wenigen Stunden nicht gekannt hatte, in den Arm und hielt sie lange fest. „Darf ich die Briefe bis morgen behalten?“
Delia nickte. Sollte sie die Briefe nur noch ein paarmal lesen, wenn sie das wollte. Martje hatte von Annemaries Vergewaltigung bisher nichts gewusst und der Schock saß nun tief. Dass Delia das Ergebnis dieses Verbrechens war, schien bei ihr noch nicht angekommen zu sein. Darüber würden sie dann morgen sprechen. Für Martje war das vermutlich nicht so besonders aufregend und auch für Delia gab es nicht mehr viel Neues zu erfahren. Annemaries Geschichte war schon fast zu Ende erzählt, denn der Unfall, bei dem die ganze Familie Ekhoff getötet worden war, musste schon bald nach dem letzten Brief Annemaries an Enna passiert sein. Damit erklärte sich auch, warum es keine weiteren Briefe gab.
Delia ging zurück zur Hauptstraße und wartete an der Haltestelle auf den Bus. Sie stieg in den ersten, der anhielt, obwohl er in die falsche Richtung fuhr. Aber schließlich war sie auf einer Insel. Ganz egal, in welche Richtung sie fuhr, irgendwann würde sie an ihrem Ziel ankommen. Außerdem war eine Inselrundfahrt genau das, was sie jetzt brauchte. Nicht nur Martje hatte vieles erfahren an diesem Nachmittag, was sie nun erst verarbeiten musste. Auch sie selbst konnte das Gehörte nicht einfach wegstecken. Was für eine Kindheit, was für eine Jugend hatte dieses Mädchen durchlebt. Ein vom Krieg traumatisierter Vater, der seine Tochter nicht wirklich wahrnahm, sondern in ihr nur einen Ersatz für seine verlorenen Söhne sah. Eine Mutter, die mit Sicherheit mindestens ebenso sehr unter deren Verlust litt und die glaubte, dem Vater helfen zu können, indem sie sein Verhalten der Tochter gegenüber zuließ, solange diese ein Kind war. Die es zugleich aber als ihre Aufgabe sah, aus dem Wildfang schließlich doch eine richtige Frau zu formen, wie die Inselgesellschaft es von ihr erwartete. Eltern, die gemeinsam dafür Sorge trugen, unter allen Umständen nach außen den Schein zu wahren, ganz egal, was geschah und wie ihr Kind darunter litt. Was das Kind sich wünschte, interessierte niemanden. Was das heranwachsende Mädchen wollte oder nicht wollte, noch weniger.
Ein Patriarch, eine im Lauf des Lebens hart gewordene Frau, die das Erbe des dem Geschlecht geschuldeten Verzichts auf ein selbstbestimmtes Leben an ihre Tochter weitergab, und ein Vergewaltiger bestimmten das kurze Leben der Annemarie Ekhoff. Martje und Enna waren lediglich kleine Sandbänke gewesen, auf denen Annemarie zwischendurch Luft holen konnte, bevor die Flut zurückkam.
Allerdings hatte der Wind schon seit geraumer Zeit zugenommen. Er kam in Böen und Madiha musste schnell feststellen, dass sie das Tempo besser reduzieren sollte. Manchmal musste sie sich gegen den Wind lehnen, um nicht von der Straße geblasen zu werden, dann war es ganz plötzlich windstill und sie wäre fast umgefallen, weil sie zu sehr in Schräglage geraten war. Nun verstand sie auch, warum sie seit einiger Zeit kein Motorrad mehr gesehen hatte und sie erinnerte sich an den alten Mann im Café, der zu ihr gesagt hatte: „Es ist sehr schön am Meer, aber es gibt viel Wind.“ Sie verstand nun, was er damit hatte sagen wollen.
Die letzten Kilometer waren mühsam. Sie musste wegen der Böen mit äußerster Konzentration fahren und war froh, als endlich der Wegweiser zum Campingplatz auftauchte. Noch hundert Meter zwischen dicht stehenden Bäumen, die den Wind größtenteils abhielten, einen Waldweg entlang, dann stand sie vor einem verschlossenen Eisentor. Es dämmerte schon und Madiha wurde es beinahe unheimlich, als eine alte Frau in der Aufmachung einer ungepflegten Diva das Tor öffnete und ihr bedeutete auf den Platz zu fahren. Madiha hielt nach wenigen Metern an und sah sich um. Die Alte war gerade dabei, die Flügeltüren mit einer Kette und einem Schloss zu sichern und Madiha fühlte sich unwohl. Aber nun war sie einmal da und weiterfahren kam nicht in Frage, da es schon bald dunkel wurde und sie außerdem endlich ihre Blase leeren und ihre steifen Knochen dehnen musste.
Ein paar Meter weiter unter Bäumen und mit direkter Sicht auf die Einfahrt stand ein alter Wohnwagen. Er war einmal weiß gewesen, inzwischen aber eher grün von Moos und das Dach bedeckt mit allem, was von den Bäumen, wohl im Lauf der letzten Jahrzehnte, heruntergefallen war. Die alte Diva ging zum Wohnwagen und winkte Madiha, sie solle ihr folgen. Laut bellend kam ein zerzauster Pudel herausgeschossen, als die Alte die Tür öffnete. Er umkreiste Madiha in raschem Tempo, so dass sie stehen blieb und nicht wusste, wie sie in den Wagen steigen sollte. Die Alte rief mit krächzender Stimme nach dem Hund, der erstaunlicherweise aufs Wort folgte, im Wohnwagen verschwand und sich wachsam vor dem Stuhl, auf dem sie sich mittlerweile niedergelassen hatte, auf den Boden legte. Sie sah geschäftig aus. Mit einem vergilbten Block vor sich auf dem Tisch, einer Brille mit riesigen Gläsern und verbogenem Gestell im Gesicht und einem Stift in der Hand wartete sie auf ihren Gast. Madiha betrat vorsichtig das Heim der Diva und sah sich neugierig um. Es war alles da, was die Alte zum Leben brauchte: Ein Bett, eine nicht gerade saubere Küchenzeile an der Wand, vor dem Bett ein Tisch und zwei Stühle. Auf dem Tisch stand eine Vase mit sehr verstaubten Plastikblumen, die wohl jemand einmal auf dem Rummel geschossen hatte. Eine Flasche Genever und ein halbvolles verschmiertes Glas rundeten das Stillleben ab. Der Raum war erfüllt von Vogelgezwitscher und Madiha fühlte sich von vielen Augen beobachtet. Wo es einen freien Platz gab, stand ein Vogelkäfig. Sie versuchte ganz flach zu atmen, um den Gestank, der aus den wohl länger nicht gesäuberten Käfigen strömte, möglichst nicht in ihre Nase zu lassen. Vorsichtig setzte sie sich auf den freien Stuhl und wartete, was nun geschehen würde.
Die alte Diva nahm das Glas vom Tisch und hob es Madiha entgegen, die kurz befürchtete, sie würde ihr anbieten, einen Schluck daraus zu nehmen.
„Gezondheid“, sagte sie jedoch und nahm selbst einen Schluck. Dann fuhr sie auf Deutsch fort: „Ich spreche französisch, deutsch, englisch, niederländisch – was Sie wollen.“
Madiha antwortete nicht, sondern nickte nur. Möglichst den Mund nicht öffnen, dachte sie, mir wird sonst übel.
„Nun sagen Sie mir schon Ihren Namen und Ihre Adresse, dann zeige ich Ihnen, wo Sie Ihr Zelt aufstellen können.“
Madiha war froh, als sie, gemeinsam mit Diva und Pudel, den Wohnwagen endlich wieder verlassen durfte. Ein Papagei auf ihrer Schulter fehlt noch, dachte sie und holte erst einmal tief Luft, nachdem sie ein paar Meter gegangen waren. Die Alte führte sie zu einem Platz direkt am Zaun, der den Campingplatz von der benachbarten Weide, die sich am Waldrand entlang zog, abgrenzte. Madiha hielt Ausschau nach dem Strand, der war aber weit und breit nicht zu entdecken. Nicht einmal Meeresrauschen konnte sie hören, dafür das Rauschen der Bäume im Wind.
Und noch ein Probekapitel zum Einlesen.
Der Mann neben ihr am Strand schreit: „Lauf!“ Und noch einmal: „Los! Lauf!“
Sie versteht, obwohl es nicht ihre Sprache ist, in der er es ihr zuruft. Und so läuft sie los, ohne nachzudenken, ohne zurückzusehen. Sie läuft einfach los und hört erst wieder auf zu laufen, als sie sich allein in einem kleinen Dorf wiederfindet, mitten auf dem Dorfplatz. Angestarrt von einer Sechsjährigen, die gedankenverloren in der Nase bohrt. Und von einem Alten, der auf seinen Stock gestützt vornübergebeugt auf einer Bank sitzt und in regelmäßigen Abständen kleine Rauchwölkchen in die Luft entlässt.
Der Alte und das Kind scheinen nichts miteinander zu tun zu haben, und als sie mitten auf dem Platz zusammenbricht, erstarrt das Kind, zieht den Finger aus der Nase und läuft weg. Der Alte bläst weiterhin seine Wölkchen, er sieht sie nicht und hört sie nicht. Er sieht und hört wohl gar nichts mehr – hat schon genug in seinem langen Leben gesehen und gehört, sodass es ihm für alle Zeiten ausreicht.
„Europa ist frei. In Europa wirst auch du frei sein“, so hatten sie gesagt. Und diese Hoffnung auf Freiheit hatte sich in ihr eingebrannt und ließ sie alles auf sich nehmen, was diese Reise, die eigentlich keine Reise war, mit sich bringen sollte. Reisen war etwas Freiwilliges. Sie aber hatte sich nicht aus freiem Willen auf den Weg gemacht. Sie musste weg, musste los, musste alles hinter sich lassen, um frei zu sein – um zu leben.
Auf ihrem Weg begegneten ihr viele, die zu Hause nichts mehr hielt, die es lieber gegen die Fremde eintauschen wollten, weil sie der Überzeugung waren: „Europa ist frei. In Europa wirst auch du frei sein.“
Trotz der riesigen Entfernung waren auch bei ihnen vor einigen Jahren die Bilder einer stürzenden Mauer angekommen, die ein Land mitten in Europa jahrzehntelang geteilt hatte. Bilder von Zäunen am Rande des damaligen Europas, die abgebaut wurden. Nein, nie wieder würde es Mauern geben in Europa oder Zäune, so hieß es. Europa ist jetzt frei und wird frei bleiben.
Und frei sein hieß doch zu tun und zu lassen, was man wollte. Zu heiraten oder nicht, zu lieben, wen man wollte, zu essen zu haben, wenn man hungrig war, und vor allem, leben zu können – ohne Angst vor bewaffneten Männern mit oder ohne Uniformen, die mit einem anstellen durften, was ihnen gerade in den Sinn kam.
Und so war sie eines Nachts aufgebrochen, nur mit dem Notwendigsten bei sich, und hatte alles und alle zurückgelassen. Sie war allein und konnte gehen, musste kein Kind mit sich nehmen und keines zurücklassen.
„Lauf! Los, lauf!“, flüsterte jemand hinter ihr, als sie mit dem Rucksack, in dem alles war, was sie für ihr neues Leben brauchte, auf die Straße trat und dort noch einmal zögerte, den Schritt aus ihrem alten Leben hinaus zu tun.
„Lauf! Los, lauf!“
Sie wusste nicht, hatte wirklich jemand geflüstert oder bildete sie es sich nur ein? Sie sah nicht mehr zurück, sondern lief einfach los. Sie musste sich beeilen, die ersten Anzeichen der Dämmerung waren in der Ferne schon zu erkennen. Sie sah nicht mehr zurück und sie beschloss in diesem Augenblick, niemals mehr zurückzublicken. Sie wollte vergessen, was hinter ihr lag, wer sie war und woher sie kam. Sie hatte es schon vergessen. Sie lief und lief, bis sie nicht mehr konnte. Suchte einen sicheren Ort zum Ruhen, aß und trank, was sie mitgenommen hatte, und dann lief sie weiter. Irgendwann hörte sie auf zu laufen und verfiel in eine gemächlichere Gangart, um nicht die Blicke der Menschen auf sich zu ziehen. Wer läuft, macht sich verdächtig. Wer mit einem prallen Rucksack auf dem Rücken läuft, macht sich sehr verdächtig. Also schritt sie nun zügig voran. Immer Richtung Norden, der Freiheit entgegen.
Sie ging bei Tag und sie lief in der Nacht, und wenn sie einen sicheren Platz fand, schlief sie. In den Dörfern unterwegs versorgte sie sich mit dem Nötigsten und so vergingen die Tage, einer nach dem anderen. Sie zählte sie nicht.
An jedem neuen Tag löschte sie die Erinnerung an den vergangenen. Erinnern wollte sie sich erst wieder, wenn sie in Europa war. Ab dem ersten Tag ihres neuen freien Lebens würde sie wieder zulassen, dass sich die Tage in ihre Erinnerung einprägten. Das alte Leben aber sollte für immer vergessen bleiben.
Als Fadia, die Tochter marokkanischer Einwanderer, erfährt, dass ihr Vater sie zwangsverheiraten will, läuft sie von zu Hause weg. Wenige Kilometer weiter strandet Damaris aus Saudi-Arabien auf der Flucht in Deutschland. Als ihr Mann, von dem sie unterwegs getrennt wurde, sie ausfindig macht, möchte sie nicht zu ihm zurück, denn in den vielen Monaten nach der Trennung hat sie ihre Selbstständigkeit entdeckt und sich mit Jane aus Uganda angefreundet. Als Jane ihr dann gesteht, dass sie sich in sie verliebt hat, stellt das Damaris vor Entscheidungen, die ihr bisheriges Weltbild ins Wanken bringen.
Fadia und Damaris treffen in einem Frauenhaus zusammen. Als sie dort eines Tages von den Männern der Familien entdeckt und mit Gewalt weggeholt werden sollen, kommt Hilfe aus einer völlig unerwarteten Ecke.
nie wieder zurück ist ein bewegender Roman, der das Konstrukt fester Kulturen infrage stellt und zeigt, wie Frauen sich ihr Recht auf Entfaltung und ein selbstständiges Leben nehmen.
Bevor ich das Auto des Nachbarsjungen reparierte, woraufhin mein Onkel ausrastete und mir erklärte bzw. erklären ließ, dass er mich schnellstmöglich verheiraten würde, hatte ich mir keine Gedanken darüber gemacht, was es für mich bedeutete, als Frau im Kosovo leben zu müssen. Ich hatte wohl bemerkt, dass die Frauen und Mädchen um mich herum keinen Fuß auf den Boden brachten, wenn sie nicht, mit welchen Tricks auch immer, einen Mann auf ihrer Seite hatten. Aber das hatte ich nie mit mir und meinem eigenen Leben in Verbindung gebracht. Ich war auch hier im Kosovo die selbständige und coole Amra. Frauen, die Unterstützung brauchten, waren andere.
Mich verheiraten zu wollen war für mich zunächst nur eine irre Idee meines Onkels. Sie ängstigte mich nicht, denn ich bestimmte über mich immer noch selbst, davon war ich überzeugt. Aber es riss mich doch aus meiner ignoranten Lebensrealität, die ich mir geschaffen hatte: Nichts sehen, nichts hören und auf bessere Zeiten warten.
Es war unsinnig gewesen, ihn so anzuschreien, er verstand mich ja auch gar nicht. Aber es tat mir gut und mein eigenes Geschrei weckte mich aus meinem Winterschlaf.
Ich konnte nicht mehr länger warten, ich brauchte Arbeit. Auch wenn meine Sprachkenntnisse noch gering waren, sie mussten genügen.
Während ich meinen gesamten Frust der letzten Monate herausschrie, damit aber nur ein Grinsen meines Onkels hervorlockte, was mein Geschrei noch steigerte, war meine Cousine dazugekommen und hatte versucht, mich ins Haus zu ziehen, was ihr aber nicht gelang. Gemeinsam mit Nehbi, die mir die Pläne meines Onkels übersetzte, schleppte sie mich dann aufs Nachbargrundstück und drückte mich auf einen der Stühle, die vor dem Haus standen. Als wir kurz darauf alle drei mit Tee versorgt waren, erklärten mir die Frau und das Mädchen die Welt des Kosovo. Ihre Welt, die jetzt ja auch meine Welt war.
Als Frau würde ich nie eine Stelle in einer Autowerkstatt bekommen, als Frau könnte ich nicht allein leben in ihrem Land, so erklärten sie mir. Sie hätten zwar vor dem Gesetz inzwischen die gleichen Rechte wie die Männer, aber im Haus meines Onkels war er das Gesetz und Esad richtete sich nach dem Kanun, den traditionellen albanischen Rechtsvorschriften. Außerdem, so erklärten sie mir, war im Kosovo fast die Hälfte aller Menschen arbeitslos und da würde eine Frau nie und nimmer Arbeit als Automechanikerin finden. Ich käme nicht an einer Heirat vorbei, und je früher ich begann mitzuspielen, desto besser wären meine Chancen, mir zumindest den bestmöglichen Mann aussuchen zu können. Ihn müsste ich dann nur glauben machen, dass er der Chef des Haushaltes sei, eine geschickte Frau würde aber immer ihren Kopf durchsetzen, ohne dass der Mann das merkte.
Ich war mir nicht sicher, ob dieses Fazit meiner Cousine von Nehbi geteilt wurde oder ob sie uns beiden nur nicht die letzte Hoffnung auf ein einigermaßen selbstbestimmtes Leben, wie es meiner Cousine vorschwebte, zerstören wollte.
Ich hatte zugehört, versuchte zu verstehen, und was ich nicht verstand, wurde mir übersetzt. Ich widersprach nicht, staunte nur, wie ein junges taffes Mädchen, wie es meine Cousine war, diesen Alptraum einer Zukunft einfach so hinnehmen konnte. Ein Mann und Kinder, das war das Leben, das sie erwartete. Wenn sie keinen Mann in ihr Bett ließ, könnte sie nicht überleben, davon war sie überzeugt. Höchstens noch als Prostituierte – und dass ihr ein Mann lieber war als viele, das verstand sogar ich.“
Eugenie hatte Glück. Sie bekam ein Zimmer für sich allein. Die Tür ließ sich nur halb öffnen, dann stieß sie ans Bett, das die gesamte Längswand des Raumes einnahm. Hinter dem Bett war ein Fenster in die Wand eingelassen, das sich nur öffnen ließ, wenn man das Bett von der Wand abrückte. Dazu musste die Tür geschlossen sein. Am Kopfende stand neben dem Bett ein kleines Kästchen, daneben ein Stuhl, dann war die Wand zu Ende. Vor dem Stuhl gab es einen winzigen wackeligen Tisch mit einer Schublade, die sich nur mit Gewalt und viel Geduld öffnen ließ. Daneben war ein Waschbecken angebracht, von dem eine Ecke leicht abgesplittert war. Der Wasserhahn tropfte. Langsam und stetig.
Zwischen Tür und Waschbecken befand sich ein alter Metallspind, in dem jemand eine Zeitung mit ihr unbekannten Schriftzeichen und eine Tasse ohne Henkel hinterlassen hatte.
Eugenie hatte nicht ganz zwei Meter mal einen Meter, um sich zu bewegen, aber sie besaß einen Raum für sich allein und in der Tür steckte ein Schlüssel. Jemand schien sich am Schloss zu schaffen gemacht zu haben, aber es funktionierte noch.
Eugenie war fast glücklich. Der Mensch wird schnell bescheiden: Wird ihm alles genommen und dann ein wenig davon zurückgegeben, so fühlt er sich reich beschenkt. So ging es Eugenie. Und plötzlich begann der Nebel sich zu lichten. Die Schwaden waberten langsam davon, von ihr weg, hinaus durch die Ritzen des geschlossenen, aber undichten Fensters. Und der Wasserhahn tropfte. Langsam und stetig.
Eugenie ließ sich aufs Bett fallen – und landete unsanft, denn die Matratze war dünn und darunter gab es nur ein Brett. Aber das störte sie nicht. Sie lauschte dem Tropfen des Wasserhahns und ganz langsam fand sie zurück ins Spiel ihres Lebens. Sie war noch immer am Zug, auch wenn sie sich nicht an ihre letzten Schritte erinnern konnte. Sie war immer noch dran und ab jetzt würde sie wieder aktiv und bewusst spielen, alle Wege ausprobieren, um am Ende den richtigen zu finden, der sie ans Ziel führte.
Sie verstaute ihre wenigen Utensilien im Blechspind, der zwar verbeult und rostig, aber doch einigermaßen sauber war. Dann zog sie den Schlüssel aus dem Schloss der Zimmertür und befestigte ihn an einem kleinen Plüschlöwen, der einen Schlüsselring trug. Seraba hatte ihn ihr beim Abschied geschenkt. „Das ist Seraba“, hatte sie gesagt, „und der hier“ – sie zeigte Eugenie einen zweiten ebensolchen Löwen – „der hier ist Eugenie, der bleibt bei mir. Eines Tages werden die beiden Löwen wieder zusammen sein.“
Eugenie barg den kleinen Löwen in ihrer Hand und erinnerte sich. Dann gab sie sich einen Ruck und verließ das Zimmer. Sie schloss ab und begann damit, das Haus zu erforschen, das nun für die nächste Zeit ihr Zuhause sein würde. Ihr Zimmer befand sich im Erdgeschoss. Von einem langen, breiten und dunklen Flur gingen viele Türen ab, hinter denen sich andere Zimmer und andere Menschen befanden. Die alte Kaserne besaß drei Stockwerke und unzählige verschieden große Räume, einige so klein wie das von Eugenie, die meisten aber groß und mit mehreren Bewohnern besetzt. Aus den Türen tönte Musik aller Art, Streit, Lachen, Kindergeschrei und ein Gewirr vieler unterschiedlicher Sprachen. Im Erdgeschoss gab es eine große Küche, deren Einrichtung aus ein paar sehr alten Herden bestand, die teilweise ihre Drehschalter und Knöpfe verloren hatten. Geputzt worden waren sie wohl schon lange nicht mehr. Genauso wenig wie das große Spülbecken aus ursprünglich weißem Porzellan, das viele Risse aufwies und wohl nicht ganz dicht war, wie die Pfütze darunter ahnen ließ. Eugenie konnte sich nicht vorstellen, hier zu kochen, auch wenn der appetitliche Geruch, der in der Luft hing, ihr Hunger machte. Es konnte noch nicht allzu lange her sein, dass hier gekocht worden war, obwohl sich nirgends eine Menschenseele blicken ließ.
Sie ging weiter, der unterwegs immer stärker werdende Geruch nach Urin zeigte ihr den Weg zu den Toiletten. Sie warf einen kurzen Blick hinein, schloss aber schnell die Tür wieder hinter sich und ging die Treppe hinauf ins erste Obergeschoss, in der Hoffnung, dort etwas bessere Zustände vorzufinden. Im ersten Stock gab es keine Küche, dafür Gemeinschaftsduschen, die nur unwesentlich sauberer waren als die Toiletten im Erdgeschoss. Die einzelnen Duschkabinen waren durch Bretterwände, die unten und oben offen waren, voneinander abgetrennt. Ein Vorhang aus Plastik verschloss die Kabine nach außen. Bei den meisten waren einige Ringe ausgerissen und Eugenie unterteilte die Kabinen in gute und schlechte, je nachdem, ob die Aufhängung in der Mitte oder am Rand defekt war, was dann keinen vollständigen Sichtschutz bot. Zu allem Überfluss schien es keine getrennten Duschen für Männer und Frauen zu geben. Auch der dritte Stock war nicht besser. Es roch noch schlimmer nach Urin als unten. In der Mitte hatte Eugenie keine Toiletten finden können, was den fehlenden Geruch erklärte. Duschen gab es keine, Toiletten und Küche waren in einem ähnlichen Zustand wie im Erdgeschoss.
Besonders willkommen schien sie den Deutschen nicht zu sein, überlegte Eugenie, während sie die Treppe wieder nach unten ging.
Seit Tagen hatte ich nicht mehr geschlafen. Sobald ich mich ins Bett legte und die Augen schloss, kamen sie zu mir. Weiße, braune, schwarze Gesichter. Frauen, Männer, Kinder. Alte und Junge. Ein Mann trug sein ertrunkenes Kind auf dem Arm, von dem das Wasser in mein Bett tropfte, eine Frau hielt mir ihr steifes, erfrorenes Baby hin, als ob sie es mir geben wollte. All diese Gestalten, all diese Menschen hatte ich ins Elend, wenn nicht sogar in den Tod geschickt, so schien es mir. Auch wenn sie nur schweigend um mich herumstanden, so glaubte ich doch zu hören:
„Du hast uns weggeschickt, du hast entschieden, dass wir gehen müssen. Zurück in ein Land, in dem wir nicht leben können. In dem sie uns nicht in Ruhe leben lassen.
In ein Land in dem wir nicht leben können, weil wir keine Arbeit haben, kein Haus, kein Essen für unsere Kinder. Weil die meisten so arm sind, dass es gerade mal zum Überleben reicht, aber nicht zum Leben. Und für manche noch nicht einmal dazu.
In ein Land, in dem sie uns nicht in Ruhe leben lassen. Weil wir Roma sind, weil wir lesbisch sind oder schwul oder transsexuell. Weil wir Frauen sind und deshalb ständig in Gefahr und ohne Möglichkeit, jemals unser eigenes, unabhängiges Leben zu leben.
Du hast entschieden, dass wir gehen müssen, weil es kein besonderes Gesetz in unserem Land gibt, das bestimmt, dass wir verfolgt werden für das, was wir sind. In ein Land, in dem es aber auch niemanden gibt, der unsere Unterdrückung verhindert.“
Ich drehte mich weg, aber auf der anderen Seite des Bettes standen sie auch. Obwohl da die Wand war, starrten mich auch von dieser Seite die Gesichter an und ich hörte ihre stummen Vorwürfe. Ich zog die Decke über den Kopf, wollte nichts mehr sehen und nichts mehr hören, wollte nur meine Ruhe haben und schlafen. Schlafen ...
Aber auch in den Schlaf hinein verfolgten sie mich. Ob ich die Augen geöffnet oder geschlossen hatte, immer sah ich sie da stehen, sah ihre Blicke und hörte ihre Klagen gegen mich. Dann dämmerte ich weg und der Traum führte mich vor ein Tribunal. Ich war die Angeklagte, vor mir saßen mehrere Richter in ihren schwarzen Roben und blätterten in meinen Akten. Ich konnte genau sehen, dass dies von mir angelegte Akten waren. Schicksale, über die ich entschieden hatte oder über die ich noch entscheiden musste. Ich drehte mich um, weil ich es hinter mir raunen hörte und sah wieder ihre Gesichter. Weiße, braune, schwarze Gesichter. Alte Gesichter und junge, die schon fast genauso verbraucht und gezeichnet wirkten wie die der Älteren. Ich wollte aufstehen, versuchte verzweifelt von meinem Stuhl hochzukommen und erwachte, als es nicht gelang. Aber im Erwachen war keine Rettung, denn nun standen sie wieder um mein Bett herum und sahen mich an. Sahen mich an mit diesem verlorenen, diesem verzweifelten Blick, den ich in den letzten Monaten immer und immer wieder bei all den Menschen gesehen hatte, die vor mir in meinem Büro saßen, mit schwitzenden Händen, unruhigen Füßen und einem Geruch nach Angst, der mich nach jedem Interview das Fenster aufreißen ließ.
„Setz dich!“ Ghaffar ließ sich auf einem Sitzkissen nieder.
„Bacha Bazi kann man nicht mit einem Wort erklären. Wenn du wissen willst, was dein neuer Freund macht, dann musst du dir ein wenig Zeit nehmen.“
Shirin setze sich Ghaffar gegenüber. Sie wunderte sich über Ghaffars Verhalten, freute sich aber auch, dass er bereit war zu reden und sie nicht wie ihre Mutter und Faruk mit ihrer Frage einfach stehen ließ.
„Pass genau auf“, begann Ghaffar. „Es ist kompliziert und ich muss ein wenig ausholen.“
Ghaffar setzte sich zurecht, ganz wohl war ihm bei der Sache nicht. Es fiel ihm nicht leicht, über all das zu reden, was er Shahin nun erklären musste, aber was sein musste, musste eben sein.
„Hat dir schon mal jemand erklärt, was zwischen Männern und Frauen passiert? Weißt du, woher die Kinder kommen?“
Shirin sah Ghaffar fragend an, eigentlich wollte sie etwas ganz anderes wissen, nicht, woher die Kinder kamen. Schließlich war sie kein Baby mehr und wusste genau, dass die Kinder aus dem Bauch der Mutter kamen. Allerdings, wie sie da hineingekommen waren, darüber hatte sich Shirin noch nie Gedanken gemacht. Aber was das nun mit Jungenspielen zu tun hatte, war ihr schleierhaft, doch sie wollte Ghaffar nicht unterbrechen, aus Angst, wieder nicht zu erfahren, um was es bei Bacha Bazi ging und was Faruks Geheimnis war. Sie sah Ghaffar fragend an und der fuhr fort.
„Früher lebten in Afghanistan Männer und Frauen anders als jetzt, jedenfalls in den Städten, in vielen kleinen Dörfern war es wohl immer schon so wie heute. Jungen und Mädchen gingen in die Schule, konnten studieren, wenn sie wollten und anschließend einen Beruf ausüben.“
Shirin erinnerte sich an die Erzählungen ihrer Großeltern und nickte.
„Mädchen und Jungen trafen sich in Teestuben oder in der Universität, sie lernten sich kennen, verliebten sich und heirateten, wenn sie sich liebten und für immer zusammenbleiben wollten. So habe ich meine Frau kennengelernt. Wir haben geheiratet, haben beide gearbeitet, sie war Lehrerin und ich Lehrer, wir haben zusammen Konzerte besucht und sind im Park und in der Stadt spazierengegangen. Wie damals leben wir beide heute noch zusammen. Wir lieben uns und respektieren uns, niemand von uns ist wichtiger als der andere oder hat mehr zu sagen. Wir entscheiden gemeinsam, wie wir leben wollen. Aber das kann in dieser Zeit nur noch zu Hause so geschehen. Heute soll eine Frau möglichst nicht mehr aus dem Haus gehen und wenn doch, dann mit einer Burka bekleidet. Die Gesetze sind neuerdings nicht mehr ganz so streng, wie es eine Zeit lang war, aber dennoch hat sich im Großen und Ganzen nicht viel geändert. Zwar dürfte meine Frau nach dem Gesetz jetzt wieder als Lehrerin in einer Mädchenschule arbeiten, aber aus irgendwelchen Gründen bekommen wir beide keine Erlaubnis, wieder in die Schule zu gehen. Man muss bei den Warlords und den Staatsbediensteten beliebt sein, heutzutage, wenn man etwas erreichen will.“
Shirin nickte. Auch ihr Vater hatte ja nicht mehr in seinem Beruf arbeiten dürfen, weil die Großeltern sich unbeliebt gemacht hatten. Aber sie sagte nichts, sondern wartete darauf, dass Ghaffar fortfuhr.
„Aber ganz egal, ob eine Frau heute wieder arbeiten darf oder nicht, sie hat im öffentlichen Leben nichts zu suchen. Nicht bei uns in der Stadt und erst recht nicht auf dem Land. Wo Männer sind, haben Frauen nicht zu sein. Ich kann meine Frau also nicht mehr mitnehmen, wenn ich mit Freunden feiern möchte, sie darf nicht mit mir im Laden arbeiten, sie darf eigentlich gar nichts. Wir Männer, so heißt es, sind besser und wichtiger als die Frauen und diese sollen uns gehorchen. Und wenn die Frau ihrem Mann nicht gehorcht, dann ist der bei den anderen unten durch. Dann ist er kein richtiger Mann und wird ausgelacht und je nachdem, was er tut, was er seine Frau machen lässt, sogar bestraft.“
Shirin fand es zwar sehr spannend, was Ghaffar da erzählte, es war genau das Leben, wovor sie sich gefürchtet hatte, als sie noch Shirin war und wusste, dass genau das auf sie wartete, wenn sie älter wurde. Aber sie musste eigentlich wieder los, die Kunden der zweiten Runde warteten sicher schon und Ghaffar machte den Eindruck, als würde er noch den ganzen Tag weitererzählen, wenn sie ihn nicht unterbracht.
„Aber, Ghaffar, was ist Bacha Bazi?“, warf sie deshalb ein, als der Teehändler eine kleine Pause machte.
„Was soll das?“, rief Danny mehr verwirrt als erschrocken. „Habt ihr einen Vogel? Schließt sofort die Tür wieder auf.“
Er ging zum Tisch, stellte den Pappkarton ab und zog sein Handy aus der Jackentasche. „Macht sofort den Weg frei, oder ich rufe die Polizei“, sagte er dramatisch. Er hörte sich an, als ob er einem Kriminalfilm entlaufen wäre.
Da er zur Tür sah, während er mit den Dreien, die ihm den Rückweg versperrten sprach, bemerkte er zu spät, dass Abdo und Slash sich ihm von hinten näherten. Sie schlichen an Danny heran und als sie nahe genug waren, nahm Slash ihm das Handy weg. Danny war zu verdattert, um etwas zu unternehmen und hielt sich am Tisch fest.
„Was soll das? Was wollt ihr von mir?“, fragte er schließlich. Ziemlich schnell hatte er sich vom ersten Schrecken erholt und begann zu lachen. „Habt ihr einen an der Klatsche, ihr Mistgören? Macht sofort die Tür auf oder muss ich euch zeigen, dass man sich mit mir besser nicht anlegt? Ich will es euch nochmal durchgehen lassen, ihr Zwerge, wenn ihr sofort den Schlüssel rausrückt und den Weg freigebt. Falls nicht …“
„Was dann, falls nicht?“, ergriff nun Luke das Wort und baute sich vor Danny auf. „Du hast eine ganz schön große Klappe. Wir sind vielleicht kleiner als du, aber wir sind zu fünft, falls dir das entgangen sein sollte.“
„Na und?“ Danny drehte sich einmal um sich selbst. „Maximal drei von euch zählen“, sagte er dann, „oder nein, zweieinhalb. Die mit dem Rollstuhl kann man ja schon mal von vorneherein vergessen. Das kleine Würstchen aus Afrika scheint mir auch nicht gerade der Stärkste zu sein; und dann noch ein Mädchen, das zwar laufen kann, aber sonst halt doch nur ein Mädchen ist.“
Lena war schneller bei Danny, als der reagieren konnte. Sie knallte ihn auf den Stuhl, der rücklings vor dem Tisch stand, während Ferrari mit Schwung angefahren kam und direkt vor Danny stehen blieb. Sie legte die Bremse ein und Danny war nun eingeklemmt zwischen Ferraris Gefährt und der Stuhllehne.
„Los Abdo, zeig ihm wer hier klein und schwach ist“, ermutigte Slash den Freund, der in der Zwischenzeit auf den Tisch gesprungen war und nun von oben herab Danny und die Lehne des Stuhls mit einem Seil umwickelte, bis der Junge sich nicht mehr bewegen konnte.
„Macht mich sofort los! Was ist das für ein Kindergarten hier? Ich mach‘ euch alle fertig, einen nach dem anderen, bis ihr selbst nicht mehr wisst, wie ihr heißt.“ Danny tobte und die fünf Doppelpunkte standen um ihn herum und sahen interessiert zu. Geduldig warteten sie, bis ihr Gefangener sich schließlich in sein Schicksal ergab.
„Was wollt ihr denn von mir, warum tut ihr das?“, fragte er leise, nachdem er sich beruhigt hatte. Danny hörte sich nun fast ein wenig ängstlich an.
Die fünf sahen sich an, dann sagte Luke langsam und überdeutlich: „Du, Danny, hast den Knochen-Paul gestohlen!“
Alle warteten sie gespannt, was nun folgen würde. Hundertprozentig sicher waren sie sich nicht, ob sie mit ihrem Verdacht richtig lagen. Aber wenn ihre Taktik funktionierte, dann würde sich nun alles aufklären.
Danny sagte nichts. Aber seine Augen wurden groß und er selbst ganz klein auf seinem Stuhl.
Ziemlich uncool, wie er da in den Seilen hängt, dachte Luke und der große Junge tat ihm fast schon leid.
Ferrari, die auf Augenhöhe mit Danny war, funkelte ihn erbarmungslos an. „Wo ist der Knochen-Paul? Was hast du mit dem Skelett angestellt?“
Sie setzte noch eins drauf. „Wir wissen genau, dass du das warst. Mit deinem Lastenfahrrad hast du ihn weggebracht.“
„Aber“, sagte Danny, „aber ich …“
„Jetzt behaupte bloß nicht, dass du das nicht warst.“ Lena war fest entschlossen, ihn so lange in die Ecke zu treiben, bis er alles zugab. Sie sah Slashs unsicheren und Abdos etwas ängstlichen Blick, ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Sollte Danny erst mal beweisen, dass er es nicht war, der das Skelett geklaut hatte.
„Wir wissen alles über deinen Großonkel. Also versuch nicht, dich rauszureden.“
Dannys Augen wurden noch größer und er rutschte, soweit ihm das möglich war, unruhig auf dem Stuhl herum.
„Wo hast du deinen Großonkel hingebracht?“, fragte Luke. „Hast du ihn etwa auf den Müll geschmissen? Nein, ich weiß, du hast die Knochen deinem Hund gegeben. Er sollte sie zerbeißen und die Reste verbuddeln, damit niemand das Skelett finden kann.“
„Neiiiiiiiiiiin“, schrie Danny, ohne weiter nachzudenken. „Ich lasse doch den Hund nicht meinen Großonkel fressen. Spinnst du? Das Skelett liegt im …“ Er verstummte, als er merkte, dass er in die Falle gegangen war.